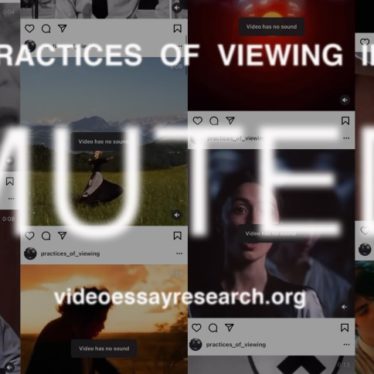SB: Johannes Binotto, du beschäftigst dich seit über seit deiner Jugend Jahren mit Filmen – unterdessen vor allem in deiner Forschung aus kulturwissenschaftlicher, kulturgeschichtlicher und psychoanalytischer Perspektive. Als Dozent an der Hochschule Luzern setzt du dich zudem mit Film- und Medientheorien sowie mit verschiedenen Filmtechniken auseinander. Und du machst seit vier, fünf Jahren selbst auch Filme, sogenannte Videoessays. Über diese möchte ich gerne mit dir sprechen. Zuerst aber: Was interessiert dich am Medium Film?
JB: Das Medium Film ist aktuell wichtiger denn je. Wir sind überall von Bewegtbildern umgeben: Wir konsumieren sie nicht nur auf News- und Social-Media-Plattformen, sondern machen selbst auch mit unseren Handykameras Bilder und kurze Videos. Nach dem Fernsehen kommt das einer weiteren Medienrevolution gleich. Lange Zeit waren Filmkameras sehr teuer und dadurch nur Personen, die professionell filmten, zugänglich. Mit der Super-8-Kamera und neueren Videokameras konnten Laien ab den 1980er-Jahren zwar bereits ihre eigenen Filme drehen, erst mit dem Smartphone ist es aber für alle möglich, Filme zu sehen und zu machen. Gleichzeitig fehlt aber eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der Frage, was das eigentlich bedeutet. Und zu oft tut man diese Frage mit der Antwort ab: ‹Filmeschauen kann man automatisch, da gibt es nichts zu lernen›. Meiner Meinung nach müsste im Schulunterricht bereits eine Auseinandersetzung stattfinden zur Frage, wie wir Filme sehen und wahrnehmen. Denn wie das Lesen muss das Betrachten von Bildern und das Sehen von Filmen geübt werden. Was das Medium Film ist, wissen wir eigentlich noch nicht.
SB: Kommt daher dein Interesse, dich in deiner Forschung mit den Praktiken des Sehens auseinanderzusetzen? In der Schule lernen wir, Texte zu lesen und zu verstehen. Bei Filmen kommen ja sehr viele Ebenen mehr hinzu: Neben dem Text, also der erzählten Geschichte, den Dialogen und Voice-Overn, gibt es im Film Tonebenen, Bildmontagen, technische Effekte, …
JB: Genau. Das Sehen ist zudem abhängig vom Umstand, wie und wo ich einen Film sehe: im Kino, zuhause mit dem Beamer, auf dem Laptop oder auf dem Smartphone. Das macht einen grossen Unterschied. Es ist nie der gleiche Film, gerade weil man einzelne Elemente des Films ganz anders wahrnimmt. Zum Vergleich: Musik an einem Live-Konzert zu hören, ist ein anderes Hörerlebnis, als wenn ich die gleiche Musik per Spotify-Stream oder mit einem Plattenspieler abspiele. Was verändert sich also, wenn ich den Film zuerst im Kino und danach auf dem Smartphone sehe? Für mich ist es wie bei der erneuten Lektüre eines Buches: Wenn ich es ein zweites oder drittes Mal lese, lese ich es anders, weil ich selbst in einer anderen Stimmung oder in meinem Leben an einem anderen Punkt bin. So ist es auch bei Filmen: Ich kann sie jedes Mal neu entdecken. Der Literaturtheoretiker Roland Barthes schrieb einmal in einem Text, dass wenn wir ständig nur neue Bücher lesen, wir Gefahr laufen würden, immer nur das Gleiche zu lesen. Nur wenn wir das Gleiche zweimal lesen, würden wir etwas anderes lesen. Ich finde, das ist ein spannender Gedanke, der sich ebenfalls wieder mit dem Beispiel Musik veranschaulichen lässt. Es sind oftmals nicht die Songs, die uns auf Anhieb gefallen, sondern diejenigen, die wir mehrmals hören, die uns emotional nahe gehen. Erst wenn wir einen Song gut kennen, entdecken wir beim erneuten Hören immer wieder neue, uns noch unbekannte Facetten und nehmen ihn dadurch ganz anders wahr. Auch Kinder wollen intuitiv immer wieder die gleiche Geschichte hören, immer wieder das gleiche Bilderbuch ansehen und entdecken dadurch neue Details. Ein solches Verhalten, sich Filme mehrmals anzusehen, widerspricht natürlich der Konsumkultur und dem Sehverhalten, das die Filmindustrie von uns als Zuschauer*innen gerne hätte. Sie ist daran interessiert, dass wir möglichst viele und vor allem immer neue Filme konsumieren.
SB: Inwiefern lässt sich mittels Filmen – auch mit denen, die vor 30, 50, 70 Jahren entstanden sind – über die Zeit, in der wir aktuell leben, nachdenken?
JB: Ein Film ist wie ein Prisma, in dem sich die Zeit bricht – und zwar nicht nur die Zeit, in der der Film entstanden ist, sondern auch unsere Gegenwart. Das zeigt sich an der Debatte um die Serie «Friends». Wenn wir sie heute nochmals oder zum ersten Mal sehen, fallen uns Dinge auf, die früher nicht bemerkt oder bemängelt wurden. Zum Beispiel, wie «weiss» diese Fernsehserie ist. Die fehlende Diversität in der Besetzung wird seit zwei, drei Jahren stark kritisiert. Ich finde diese Debatte interessant, weil sie uns aufzeigt, dass wir früher einen blinden Fleck hatten. Denn es gab schon damals Personen, die darauf hingewiesen haben, diese Kritik wurde aber nicht so breit wahrgenommen, wie es heute der Fall ist. Die einen sagen, «Friends» sollte man sich nicht mehr anschauen, die anderen feiern sie als Kultserie. Ich finde, eine solche Debatte ist eine Chance, in einen Dialog mit der Serie zu treten und sich zu überlegen: Was sehe ich? Welche Themen fallen mir bei «Friends» sonst noch auf? Was sagt die Serie über die Zeit aus, in der sie entstanden ist und was sagt sie über unsere jetzige Zeit aus?
SB: An solch einer Debatte, wie sie über «Friends» geführt wird, zeigt sich auch, welche Theorien gegenwärtig zirkulieren und die öffentliche Diskussion bestimmen und auch, wie diese Theorien, die Art und Weise, wie wir sehen, beeinflussen.
JB: Die Art und Weise, wie wir sehen, ist selbst schon eine Theorie. Das Wort Theorie – lateinisch «theoria» – heisst wortwörtlich «Anschauung». Wenn wir also sehen, betreiben wir immer Theorie, egal ob wir das wollen oder nicht. Deshalb ist es wichtig, sich immer wieder zu fragen: Wie sehe ich? Was für eine Theorie wende ich dabei an und wie kann ich damit experimentieren? Sprich, wie kann ich versuchen, den Blick zu verändern?
Einer meiner Lieblingsessays stammt von der amerikanischen Feministin und Theoretikerin bell hooks [sic]. In ihrem 1992 erschienen Essay «The Oppositional Gaze», der oppositionelle Blick, beschrieb sie, dass sie als Schwarze Frau im amerikanischen Kino einen doppelten Aussenseiterstatus – also als Schwarze und als Frau – inne hatte, weil es in diesen Filmen nie eine Schwarze Frau als Hauptfigur gab. Sie weist in diesem Text auch darauf hin, dass die Filmtheorien zum «male gaze» den feministischen Blick auf Filme stark gemacht haben, aber dass diese Theorien hauptsächlich von weissen Frauen geschrieben wurden. Die Hautfarbe und Rassismus waren ein blinder Fleck dieser Theoretikerinnen. bell hooks verwirft nun aber die Theorie zum «male gaze» nicht, sondern nimmt diese als Sprungbrett und geht in ihrem Nachdenken über Filme noch ein paar Schritte weiter. Sie beschreibt zum Beispiel, wie sie und ihre Schwarzen Freundinnen begannen, diese Filme anders zu sehen, eben mit einem «oppositionellen Blick». Das heisst konkret, dass sie in ihrem Sehen die Nebenfiguren zu Hauptfiguren gemacht haben. bell hooks bewertet die Filme in ihrem Text nicht als Ausdruck einer rassistischen Kultur, sondern liest sie gegen den Strich, hat in ihrem Sehen den Film ummontiert, eine «Re-Vision» gemacht. Ich finde das eine wichtige Lektion: Wir sollten immer oppositionell sehen, immer darüber nachdenken, welche Freiheiten der Film beim Sehen gibt.
SB: In deinem Forschungsprojekt setzt du dich aktuell mit Videoessays auseinander und reflektierst in deinen eigenen Videoessays die Praktiken des Sehens. Magst du kurz erklären, was das für Filme sind?
JB: Meine Definition des Videoessays ist, dass es keine Definition gibt, beziehungsweise, dass wir noch nicht wissen, was Videoessays eigentlich sind. Manche funktionieren wie kleine Dokfilme, andere eher wie Experimentalfilme. Es sind in der Regel digitale Videos, in denen über Filme oder auch andere Themen in audiovisueller Form nachgedacht wird. Also, dass ich meine Gedanken nicht als Text aufschreibe, sondern zum Beispiel Filmausschnitte miteinander kombiniere und einen Kommentar darüber spreche. Vorhandenes Material neu zusammenzusetzen, ist keine neue Erfindung. Im Gegenteil: In Filmen werden immer mal wieder andere Filme zitiert. Neu ist, dass ich mit meinem Smartphone einen solchen Filme selbst machen kann. Während früher mit Filmrollen gefilmt wurde und diese an einem analogen Schneidetisch montiert wurden, kann ich heute Szenen mit einem einfachen Programm zusammensetzen. Es gibt aber keine Anleitung, wie man einen Videoessay macht. Ich finde den Begriff des Essays zentral: Essay heisst wortwörtlich «Versuch». Es ist also nicht eine «Videoexplanation», wie man sie zuhauf auf Youtube findet und in denen jemand erklärt, warum zum Beispiel Kubrik-Filme so toll sind und zeigt, was er*sie alles darüber weiss. Bei einem Videoessay geht es meiner Meinung nach um ein Ausprobieren, wie man einen Film – mit verschiedenen Techniken – anders sehen könnte.
SB: Als Wissenschaftler und freier Autor hast du ja bereits sehr viele Texte über Filme geschrieben. Als ich mir deine Videoessay-Reihe «Practices of Viewing» angesehen habe, musste ich an das Buch «Das wilde Denken» von Claude Lévi-Strauss denken, in dem er über die Bricolage schreibt. Die Bricolage ist eine Art des Bastelns, bei dem Artefakte und Wissen, auf das wir zugreifen können, auf neue Art und Weise in Beziehung gesetzt werden. Wie hat sich dein Nachdenken über Filme verändert, seitdem du Videoessays machst – dich also mit dem Medium Film nicht nur in Texten, sondern auch in einem audiovisuellen Format auseinandersetzt?
JB: Der Text über das Basteln ist tatsächlich einer meiner Lieblingstexte. Darin macht Claude Lévi-Strauss klar, dass das Basteln viel radikaler ist als die Vorstellung des Ingenieurs, der alles nach Plänen genau und richtig machen möchte. Das Basteln ist – entgegen seinem schlechten Ruf – eine wahnsinnig kreative Tätigkeit. Meine Videoessay-Reihe «Practices of Viewing» entsteht zusammen mit einer Kolumne für das Filmbulletin. Ich mache also zur gleichen Ausgangsfrage sowohl einen Text als auch einen Videoessay – dabei entwickeln sich meine Gedanken jedoch in jeweils komplett andere Richtungen. Dadurch, dass ich schon viele Texte geschrieben habe, in denen ich meine Gedanken theoretisch unterfüttert und mit Fussnoten belegt habe, bin ich in den Videoessays viel freier. Ich hatte zudem anfangs keine Ahnung vom Technischen, also wie man so einen Film schneiden kann. Durch meine bisherige Beschäftigung mit Theorie und Philosophie habe ich einen Blick, der etwas anders ist als bei einer*m «klassisch» ausgebildeten Filmemacher*in, und kann neue und andere Dinge miteinander in Verbindung setzen. Im Videoessay «Trace» zum Beispiel habe ich ein iPad auf einen Tisch gelegt. Das iPad zeigt ein Standbild eines Films. Neben dem iPad mache ich etwas mit meinen Händen, die das Standbild kommentieren. Von vielen ausgebildeten Filmemacher*innen bekam ich die Rückmeldung, dass diese sehr reduzierte Idee ihnen ganz neue Perspektiven darauf eröffnet habe, was ein Videoessay sein könnte. Das hat mich sehr gefreut, denn mein Anspruch ist es, dass jemand für sich etwas mitnehmen kann, dass die Videoessays ein Gedankenanstoss sind, dass ich einen Denkraum schaffen kann und vielleicht sogar jemanden inspiriere, selbst einen Videoessay zu machen.
SB: Wenn du Videoessays machst, nimmst du selbst die Rolle des Filmemachers ein, entwickelst also einen künstlerischen Zugang zum Material. Inwiefern sind die Videoessays für dich auch eine Herangehensweise, die einen «oppositionellen Blick» auf die Auseinandersetzung mit dem Material oder auf die Forschung an sich eröffnet?
JB: Ich hatte nie vor, Filmemacher zu werden. Aber dieser künstlerische Zugang ist eine Form, die mir sehr entspricht. In meiner wissenschaftlichen Tätigkeit versuchte ich immer schon die Haltung, wissenschaftliche Texte müssten möglichst trocken, distanziert und desinteressiert geschrieben sein, aufzubrechen. Und mit Roland Barthes oder auch Claude Lévi-Strauss fand ich Vorbilder, die einen kreativen, ästhetischen Anspruch an die Wissenschaft hatten. Claude Lévi-Strauss schrieb gewisse Bücher zum Beispiel nach musikalischen Prinzipien. Die Videoessays zu machen, fühlte sich für mich sehr natürlich an. Dass ich selbst in einem Videoessay auftrete, persönliche Geschichten preisgebe, ist übrigens auch etwas, was man in der Wissenschaft nicht machen würde. Etwas oppositionell zu sehen, heisst ja auch, dass man etwas Queeres im Wortsinn macht, etwas, was schräg ist, was nicht ganz in die gängigen Raster passt. Aktuell lösen sich all die Regeln auf, wie man etwas «korrekt» macht. Das kann man problematisch oder auch als Chance sehen. Bei meiner Tätigkeit als Dozent bemerkte ich, dass ich nicht voraussetzen kann, dass alle schon mal einen Film von Chaplin oder Hitchcock schon mal gesehen haben. Es gibt keine gemeinsame Basis mehr. Das verändert meinen Blick auf die Filmgeschichte: Was Filmgeschichte ist, ist nicht vorgeschrieben. So können wir im Austausch miteinander andere Filme ins Zentrum rücken als diejenigen Filme, die als «Klassiker» gelten.
SB: Im Dialog miteinander definieren, über welche Filme man spricht, setzt ja auch voraus, dass man gemeinsam über das Warum spricht, also warum du als Dozent diese Filme ausgewählt hast und andere nicht. Diese Diskussion lässt sich auch auf unsere Mediennutzung übertragen: Auf Streamingplattformen wie Netflix hat man eine riesige Auswahl an Filmen. In Kinos gibt es kuratierte Auswahlen. Welche Filme wir sehen können, wird uns durch Netflix oder durch Programmmacher*innen vorgegeben. Inwiefern spielt bei der Auswahl die Frage nach Aktualität eine Rolle?
JB: Wenn wir einen «Klassiker» nur deswegen betrachten, weil er mal wichtig war, dann können wir ihn gleich ad acta legen. Ich glaube, viele ältere Filme sind – wie es beispielsweise auch bei einem Buch von Virginia Woolf oder einem Bild von Van Gogh der Fall ist – heute noch relevant, weil sie in jeder Zeit wieder neu interpretiert werden können. Die Aktualität der Themen ist nicht etwas, worauf ein Schild im Film hinweist, sondern ich als Zuschauer*in mache diese Filme aktuell. Bei diesem «aktuell machen» geht es um das Basteln, also dass ich das, was den Film aktuell macht, mit Fragen herausarbeiten und in Beziehung setzen muss. Und gerade weil heute über Streamingplattformen so viele Filme verfügbar sind, ist die Vermittlung umso wichtiger. In Programmkinos wie dem Filmpodium und dem Xenix in Zürich oder dem Kino Cameo in Winterthur gibt es Personen, die mit ihrer Programmauswahl nach aussen kommunizieren: «Wir finden diese Filme interessant». Dadurch kann ich als Zuschauer*in in einen Dialog mit diesen Kinos treten und für mich entscheiden, ob mir ihre Auswahl gefällt oder nicht. Es gibt eine Reibung, ich kann nachfragen, warum sie diesen Film ins Programm genommen haben und einen anderen nicht. Dieser Austausch tut der Filmkultur gut. Auf Netflix hingehen ist eigentlich sehr wenig zu finden. Das klingt jetzt vielleicht komisch, weil es ja doch sehr viele Filme sind, aber es gibt keine Person mit erkennbarer Haltung, die das Programm kuratiert. Der Blick darauf, was alles da ist, ist begrenzt. Wenn jedoch die Auswahl kleiner ist, merkt man, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, diese zusammenzustellen.
SB: Nun haben es aber gerade Programmkinos schwer, ihren Kinosaal zu füllen.
JB: Das stimmt, das klassische Kino, in dem viele Zuschauer*innen in einem Saal sitzen, gibt es heute immer seltener. Die Entwicklung ist aber nicht per se schlecht, denn sie führt dazu, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, welche Aufgabe das Kino heute haben soll. Übernimmt ein Kino zum Beispiel Vermittlungsaufgaben, wie sie Museen, Theater oder Opernhäuser innehaben, braucht dieses Kino auch entsprechend finanzielle Unterstützung seitens der Stadt und des Kantons. Die Anforderung an solch ein Kino ist dann aber auch, dass es ein kuratiertes Programm zusammenstellt. Und es braucht in diesem Fall auch nicht mehr extrem viele Leute, die ins Kino gehen, aber genug, die ein Bedürfnis danach haben, über Filme zu diskutieren. Es ist nicht die Quantität, die zählt, sondern die Resonanz. Gerade mit Blick auf unseren Umgang mit Medien ist eine Reflektion über die Resonanz wichtig: Was bringt es mir, wenn ich täglich Bilder oder Textbeiträge auf Social Media poste, die wahnsinnig viele Klicks bekommen, aber nichts im Dialog mit anderen daraus entsteht? Einen Blockbuster im Filmpodium , im Xenix oder im Kino Cameo zu zeigen, lohnt sich nicht, weil nicht zwingend mehr Leute als sonst kommen. Aber das Filmpodium, das Xenix und das Kino Cameo würde damit eine Chance verpassen, den «Spirit» des Ortes zu pflegen. Filmkultur passiert über Community-Building, darüber, dass man einen Ort schafft, wo Menschen in einen Dialog treten können und sich austauschen. Es braucht einen Resonanzkörper. Resonanzkörper sind wie eine Wand, die den Schall zurückschlägt. Es ist jemand da, der auf das, was ich «sende», reagiert und es einordnet. Der Zustand, dass man in die Welt hinausruft, es aber kein Echo gibt, finde ich zermürbend. Resonanz ist damit auch ein Gegenstück zu autoritärem Populismus: Jemand wie Trump brüllt extrem laut in die Welt hinaus, ist aber selbst taub für jegliches Echo, das entsteht. Stattdessen hätten wir die Gelegenheit in einen echten Dialog miteinander zu kommen. Zum Beispiel über Filme.
Zur Person
Johannes Binotto ist Kultur- und Medienwissenschaftler, unterrichtet an der Hochschule Luzern Film- und Medientheorie und veröffentlich als freier Autor immer wieder Texte – zum Beispiel für das Filmbulletin. Zudem macht er selbst auch Experimentalfilme und Videoessays, einige waren auch schon an den Internationalen Kurzfilmtagen Winterthur zu sehen. Seit 2021 leitet er das durch den Schweizerischen Nationalfond geförderte Forschungsprojekt «Video Essay. Futures of Audiovisual Research and Teaching» (www.videoessayresearch.org)
Sandra Biberstein hat das Gespräch mit Johannes Binotto am 26. Januar 2022 geführt. Das Interview erschien auch in der Ausgabe N°104 März 22 des Kulturmagazin Coucou.
Texte und Videoessays von Johannes Binotto sind auf folegnder Webseite zu finden: https://schnittstellen.me/videoessays/
Zur Videoreihe«Practices of Viewing»: https://vimeo.com/showcase/9086821