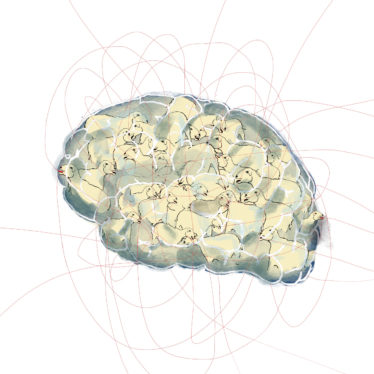- Ernüchterung, Ohnmacht, Angst
Sandra Biberstein: Mit 4’000 bis 5’000 Teilnehmer*innen war der Klima-Umzug im April 2019 die grösste Demonstration, die in Winterthur seit über 50 Jahren stattgefunden hatte. Im November 2019 waren es noch 600 Menschen, die an der Black-Friday-Demo in Winterthur auf die Strasse gingen. Weltweit tun sich die Staaten schwer mit dem Klimaschutz, auch die Schweiz. Macht sich nach der anfänglichen Euphorie Ernüchterung breit? Und was treibt euch an, weiterzukämpfen?
Emanuel Wehrli: Es war absehbar, dass die Demos mit der Zeit kleiner werden. Viele hatten anfangs das Gefühl, es gehe darum, Eisbären und Gletscher zu retten. Mit Systemkritik müssen sich die Leute zuerst befassen. Der Erfolg der Sache hängt aber nicht nur von der Zahl der Demo-Teilnehmer*innen ab. Wir sind daran neue Formen zu finden, wie wir unseren Protest zum Ausdruck bringen können. Der Erfolg der Sache hängt aber nicht von der Zahl der Demo-Teilnehmer*innen ab. Wir müssen neue Formen finden, wie wir unseren Protest zum Ausdruck bringen können.
Céline Hafner: Es ist sicher eine Enttäuschung da, weil viele, die am Anfang für das Klima eingestanden sind, das Thema beiseite gelegt haben – obwohl seither global zu wenig passiert ist. Für mich ist es keine Frage der Motivation, sondern eine Notwendigkeit, weiterzukämpfen. Trotzdem ist es so dass der Winterthurer Kern der Bewegung extrem engagiert ist. Diese Stadt ist ein Ort, an dem Menschen zusammenfinden, die im Kollektiv denken wollen. Ich vergesse manchmal, dass nicht die ganze Schweiz so ist wie Winterthur.
Caesar Anderegg: Am Anfang hatten wir die Hoffnung, dass die Menschheit erwacht, dass etwas passiert. Wir leben in einer Spektakel-Gesellschaft, in der die Leute keine Zeit haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen, sich zu informieren. Entsprechend leidet das politische Engagement darunter. Noch nie haben hunderttausende von Wissenschaftler*innen einen derartigen Konsens über so schwerwiegende Zustände geäussert. Es geht bei all dem nicht bloss um die Umweltpolitik. Das Problem hängt auch mit sozialen, ökonomischen und feministischen Fragen zusammen.
SB: Wo stosst ihr bei diesem Kampf an Grenzen?
CA: Überall. Seit einem Jahr arbeite ich mehr als 100 Prozent für den Klimastreik – und das neben dem Studium und einem Job. Das funktioniert langfristig nicht. Den Job habe ich nun aufgrund der politischen Arbeit gekündigt, das Privatleben findet nicht mehr statt. Das spiegelt sich auch in Gesundheit von Psyche und Physis wider. Man merkt es in den Gelenken, wenn man morgens aufsteht. Es macht einen kaputt. Vielen in der Bewegung geht es psychisch nicht gut. Aber wenn man einmal beginnt, kritisch zu denken, bringt das auch ein anderes Lebensgefühl, ein Lebendigsein mit sich.
EW: Für einen Job, den man macht, um Geld zu verdienen, könnte man nicht so lange so viel geben. Ich bin zwar am Limit, kann und will aber nicht aufhören zu kämpfen, es ist Teil meines Lebens geworden. Ich habe die Schule für ein halbes Jahr unterbrochen, um die Zeit für den Klimastreik zu nutzen, um mich mehr auf meine damit verbundenen Aufgaben zu fokussieren.
CH: Mir würde es psychisch schlechter gehen, wenn die Bewegung nicht wäre: Denn zu sehen, was auf uns zukommt, macht mir Angst. Aber mit all den Leuten zusammen vorwärts zu arbeiten, bringt das optimistische Denken zurück. Der weltweite Widerstand setzt der Angst etwas Hoffnung entgegen.
SB: Kannst du diese Angst genauer beschreiben?
CH: Es ist eine Angst davor, dass sich die Natur verselbstständigt und sehr viele Menschen sterben. Vielleicht nicht hier in Winterthur, sondern in anderen Gegenden der Welt. Es erfüllt mich mit Trauer, wenn Tiere sterben, wenn Familien aufgrund unseres Handelns auseinandergerissen werden.
CA: «Ich sollte lernen, aber kann mich nicht konzentrieren, die Welt macht mich so kaputt, die Trauer treibt mir Tränen in die Augen, die Verzweiflung schnürt mir die Luft ab, die Wut kocht, ich halte es fast nicht mehr aus.» Diese Gedanken habe ich vorgestern meinen besten Freund*innen geschickt. Der Hintergrund sind die Brände in Australien. Ein Ministerpräsident, der in die Ferien fährt, anstatt vor Ort zu sein; Interessensverbände, die Kohlefirmen betreiben und keinerlei Konsequenzen tragen – diese Teilnahmslosigkeit zu sehen, macht mich kaputt.
SB: Ihr seid als Kollektiv organisiert. Warum setzt ihr auf diese Organisationsform und bringt euch nicht in Parteien ein?
CA: Wir haben ein begründetes Misstrauen gegenüber politischen Institutionen, weil sie abhängig von ökonomischen Interessen handeln. Uns ist zudem wichtig, dass die Demokratie auf der Strasse stattfindet. Nur so können wir genügend Druck aufbauen.
EW: Ich bin Mitglied bei den Jungen Grünen, merke aber, dass in einer Partei aufgrund der Strukturen kein visionäres Denken stattfindet. Es ist schwierig, Parteien für eine Aktion zu gewinnen, weil es oft auch darum geht, wie eine Partei davon profitieren kann, wie sie mehr Wähler*innen gewinnen kann. Der Klimastreik hat zum Beispiel zur Klima-Charta eine Podcast-Serie gemacht und Politiker*innen gefragt, wie sie sich ein ideales Parlament vorstellen. Die Antwort von Cédric Wermuth war: eine links-grüne Mehrheit.
Das ist alles andere als visionär, sondern kurzfristig und nur innerhalb des unmittelbar Vorstellbaren gedacht. Wir fordern ein neues Verständnis von Gesellschaft und Partizipation.
- Kollektive bilden
SB: Was muss ich mir unter einem solchen neuen Verständnis von Gesellschaft und Partizipation konkret vorstellen?
EW: Die Menschen, die eigentlich das Fundament des Wirtschaftssystems sind, müssen sich wieder als politische Subjekte verstehen und ihren Handlungsspielraum ausnutzen. Sie sollen das gesellschaftliche Leben aktiv mitbestimmen können. Am 7. März planen wir eine Zusammenkunft. Es wird ein neuer, kreativerer Austausch darüber sein, wie man die Klimakrise aufhalten kann.
CH: Wir wollen mit dieser Versammlung auch diejenigen – insbesondere ältere Menschen – ansprechen, die Mühe haben, an Demos oder Streiks teilzunehmen. Sie sollen sich auf eine andere Art und Weise einbringen und dem Klimastreik anschliessen können.
CA: Inhaltlich wird es um kreativen Aktivismus, Kollektivbildung und Klimagerechtigkeit gehen. Mit dieser Versammlung werden wir die Leute auf den «Strike for Future» am 15. Mai vorbereiten. Dieser legt den Grundstein für neue gesellschaftliche Strukturen. Geplant ist, dass in der ganzen Schweiz um 11:59 Uhr – eine Minute vor Zwölf – Aktionen stattfinden. Wir arbeiten an diesem Tag mit Gewerkschaften zusammen, gehen auf Bäuer*innen zu. Es gibt aktuell in der ganzen Schweiz Workshops, um Kollektive zu bilden. Ziel ist es, die Bewegung zu verbreiten, also die soziale, ökologische, feministische, die Arbeiter*innenbewegung und damit auch allgemeine Werte von sozialer Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität und Klimagerechtigkeit zusammenzubringen.
SB: Wie wollt ihr das erreichen?
CA: Indem in allen Bereichen unseres Lebens autonome, dezentrale Kollektive gegründet werden – in Quartieren, Spitälern, Kitas oder Grossverteilern. Die Menschen setzen sich in Kollektiven damit auseinander, wie sie selbstbestimmt und mitbestimmt ihren Lebensraum gestalten und wie sie spezifisch auf einzelne Zustände reagieren können. Sie lernen, sich selbst zu organisieren: Die Arbeiter*innen in einem Grossverteiler diskutieren zum Beispiel nicht nur über Arbeitsbedingungen, sondern auch darüber, welche lokalen Produkte verkauft werden und was Foodwaste ist. Sie sollen Gegebenes in Frage stellen. In unserem Manifest haben wir es so formuliert: «All die Kollektive sollen alternative Organisationsformen schaffen, die in Frage stellen, was, wie, wo und zu welchen Bedingungen produziert und verrichtet wird». Es geht also nicht nur um Klimagerechtigkeit, sondern auch um die Demokratisierung von Boden, Zeit und Arbeitsverhältnissen.
SB: Die Idee, Kollektive zu bilden, ist ein ambitioniertes, nationales Projekt. Warum versucht ihr es nicht mit kleineren Initiativen, die lokale Firmen oder Kulturinstitutionen darüber aufklären, wie sie klimafreundlicher handeln können?
EW: Es gibt bereits viele kleine Initiativen. Diese sind wichtig für den nötigen Wandel, jedoch nicht ausreichend.
CH: Wir machen uns auch auf lokaler Ebene Gedanken. Aber für uns liegt das Problem nicht bei einer einzelnen Firma, sondern bei den globalen ökonomischen Verhältnissen, die auch die Verhältnisse in Winterthur schaffen.
CA: Fortschritt entsteht nicht im Gleichschritt. Wenn wir auf jede Person und jede Institution in der Gesellschaft einzeln zugehen, verpufft unsere ganze Energie. Der Klimastreik Winterthur hat neu das Wegbereiter-Konzept entwickelt. Darin thematisieren wir, was die Aufgabe des Klimastreiks sein soll: Wir wollen progressiv vorausgehen.
- Das avantgardistische Denken
SB: Ihr versteht euch als Vordenker*innen, die mit kreativeren Aktionsformen neue Themen setzen?
CA: Genau, in avantgardistischer Manier: Wir bereiten den Weg. In unserem Windschatten können dann verschiedene kleinere Forderungen und Bewegungen entstehen.
SB: Welches Potential seht ihr in dieser Wegbereiter-Rolle?
CA: Es geht um eine Diskursverschiebung nach Michel Foucault: Dadurch, dass wir vorausgehen und etwas aussprechen, verschieben wir das, was Realität ist, was den momentanen Werten und Normen entspricht. Wir erweitern den Raum des Sag-, Mach- und Denkbaren.
SB: Könnt ihr das anhand eines Beispiels ausführen?
CA: Die Credit Suisse stand schon vor dem Aufkommen der Klimastreik-Bewegung in Kritik: Viele ökologische und soziale Bewegungen prangerten die ökonomischen Verhältnisse an, durch uns hat sich diese Kritik zugespitzt. Der Klimastreik hat den Diskurs in der Schweiz seit dem 14. Dezember 2018 verschoben, sowohl die Bevölkerung als auch die Medien hinterfragen nun die Rolle der Schweizer Banken und weshalb sie als grösste Finanzinstitutionen der Welt in fossile Brennstoffe investieren.
EW: Ein anderes Beispiel ist die Forderung nach Netto-Null-Treibhausgas-Emissionen bis 2030. Dieses Netto-Null-Ziel bis 2030 war zuvor nicht präsent im politischen Diskurs. Vorher sprach man über die 2000-Watt-Gesellschaft. Dann kamen wir, die GLP zog nach und forderte Netto-Null bis 2040. Parteien können nicht so progressive Rollen einnehmen, wie es nötig wäre. Deshalb braucht es uns.
CA: Bei den Netto-Null-Diskussionen wird die Klimagerechtigkeit aktuell noch nicht mitgedacht. Noch wird der Schutz nationaler ökonomischer Interessen über die Menschenrechte gestellt. Aber: Wir sitzen nicht alle im gleichen Boot, einige gehen bereits jetzt unter, andere – wie die Manager*innen aus dem Silicon Valley – kaufen sich Luxusbunker auf Neuseeland. Westliche Industrienationen sollten schneller auf Netto-Null kommen, weil Länder aus dem globalen Süden die Ressourcen nicht haben, diese Forderung im gleichen Tempo umzusetzen.
SB: Netto-Null ist eine klare Forderung an die Politik. Ihr sprecht aber auch davon, dass sich die Menschen als politische Subjekte verstehen sollen. Was meint ihr damit?
CA: Wir leben in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft, es ist alles ökonomisiert, rationalisiert, auf Leistung ausgerichtet. Seit dem Aufkommen des Neoliberalismus in den 1980er-Jahren ist der öffentliche Raum immer mehr verschwunden – und mit ihm auch die sogenannte «geteilte Welt». Es fand eine Vereinzelung statt. Aus einem Gemeinschaftsgefühl kann man schliesslich keinen Profit machen. Erst wenn wir all unsere Perspektiven austauschen – Hanna Arendt nennt dies das repräsentative Denken – erst dann können wir unsere gemeinsame geteilte Realität wahrnehmen.
SB: Um in dieser «geteilten Welt» mitbestimmen zu können, müssen die Menschen als politische Subjekte Kollektive bilden und sich austauschen. Welche Vorteile seht ihr in dieser Organisationsform?
CH: Als Individuum kann ich keinen politischen Druck ausüben. Im Kollektiv bringt man sich jedoch gegenseitig weiter, auch wenn es sehr zeitintensiv ist. Wir müssen einen Konsens treffen und sind bedacht darauf, dass wir nicht systemische Zwänge reproduzieren, sondern versuchen, einander Raum zu lassen. Im Klimastreik leben wir das, was wir fordern: Jede*r kann mitmachen, jede Entscheidung treffen wir zusammen.
EW: Bei Diskussionen sind wir im Kollektiv anfangs oft gegensätzlicher Meinung. Aber wenn man sich Zeit lässt, bemerkt man, dass man dasselbe Anliegen einfach anders formuliert hat, etwas anders durchgedacht hat. Wenn man kreativ ist, schafft man es, verschiedene Ideen ins gleiche Projekt zu integrieren. Dieser Austausch ist viel sinnvoller als Themen mittels Mehrheitsabstimmung durchzuboxen.
CA: Durch unterschiedliche Meinungen und Differenzen öffnet sich ein Raum, in dem man sich aufeinander zubewegen kann. Einen Konsens zu finden bedeutet auch, das Denken der anderen nachzuvollziehen, eine andere Perspektive einzunehmen. Dadurch lernt man extrem viel. Der Kompromiss ist eher mit einem ökonomischen Tauschhandel vergleichbar. Durch den Austausch erhalten die Ideen eine Legitimation, hinter der alle stehen können. Wenn jemand alleine für alle entscheiden würde, wäre das nicht der Fall.
EW: Das neue, das im Konsens entsteht, ist viel spannender, als es die einzelnen Ideen vorher waren oder je hätten sein können. Durch den Prozess kommen immer neue Erkenntnisse hinzu.
CH: «People only support what they create.» Daran glaube ich – und das erlebe ich auch so beim Klimastreik.
- Vom Protest zu zivilem Ungehorsam
SB: Liegen nicht genau hier die blinden Flecken der Bewegung: Nicht alle im Kollektiv sind gleich redegewandt, rhetorisch gleich stark, gleich intelligent oder haben dieselben Theorien gelesen. Wie lässt sich vermeiden, dass nicht einige wenige das Kollektiv mit ihren Ideen dominieren?
CH: Wir hinterfragen uns selbst immer wieder im gemeinsamen Prozess. Wir achten darauf, dass sich Jede*r einbringen kann, sich wohl fühlt in den Diskussionen. Es geht dabei nicht nur um die Redegewandtheit, sondern auch um die Genderbalance. Gerade bei Medienauftritten ist uns wichtig, dass auch weiblich gelesene Personen vertreten sind.
CA: Wir nehmen diese Diversität im Kollektiv wahr und pflegen einen emanzipatorischen Umgang miteinander. Wir versuchen Gleichberechtigung zu schaffen und gehen davon aus, dass alle mit bestem Wissen und Gewissen für die Bewegung handeln. Aber natürlich ist es so, dass ich als Student, der vieles in Philosophie, Politik und Wirtschaft gelesen hat, nicht mit allen auf der gleichen Ebene diskutieren kann. Aber in der Bewegung gemeinsam kreativ zu sein, ist für alle gewinnbringend.
CH: Dank flacher Hierarchien können wir uns alle einbringen. Wir haben kein Interesse an Leadership, sondern arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin.
SB: Aber wenn ihr radikale Forderungen beschliesst, stosst ihr da nicht auch mal Leuten vor den Kopf?
EW: Weil wir alles im Konsens entscheiden, wird etwas, mit dem nicht alle unseres Kollektivs einverstanden sind, nie gefordert.
SB: Ende November fand ein unbewilligter Black-Friday-Protest im Einkaufszentrum Rosenberg in Winterthur statt: keine Demo, sondern ein «Die-in», bei dem sich 20 Personen wie tot auf den Boden gelegt haben. Ihr habt zudem angekündigt, vermehrt Aktionen zivilen Ungehorsams zu machen. Was versprecht ihr euch davon?
EW: Unbewilligt ist ja nicht gleich unerlaubt. Ein «Die-in» ist nicht gefährlich, wir haben keinen Schaden angerichtet. Wir machen bei Aktionen wie «Unruhe im Konsumtempel» auch nichts kaputt, obwohl wir durchaus wütend sind. Man braucht keine Angst vor uns zu haben. Wir haben einen Aktionskodex, der ein rücksichtsvolles, solidarisches Zusammenleben achtet. Zudem haben wir den Ablauf bis ins letzte Detail besprochen.
CA: Ziviler Ungehorsam ist wichtig im Sinne des Wegbereiter-Konzepts, um Denkräume zu erweitern. Man muss irgendwo stören, anecken, um die perfektionierten Abläufe und Routinen zu durchbrechen.
Das Interview hat Sandra Biberstein am Sonntag, 12. Januar 2020 in Winterthur geführt. Es wurde zuerst in der Februar-Ausgabe N°83 des Kulturmagazin Coucou veröffentlicht. Das Bild stammt von der Illustratorin Lilian Caprez.